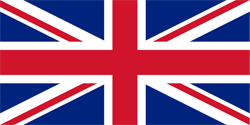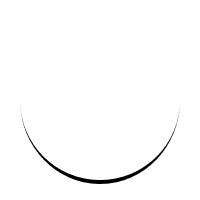Wer sind für Sie die Treiber der Entwicklungen – FinTechs, Big Techs, Endkunden oder Banken?
Die Prozesse werden aus unserer Sicht erst einmal grundsätzlich durch Technologie getrieben. Und da sind solche Big Techs einerseits unsere Konkurrenz – Google verfügt z. B. über Google Pay, um gewisse Zahlungsthemen abwickeln zu können –, andererseits sind sie aber auch ein Kooperationspartner, wenn es darum geht, Kundendaten entsprechend zu analysieren oder für das Bankgeschäft bzw. die Bankberaterinnen und Berater nützlich zu machen.
FinTechs, die sich in der Regel außerhalb des regulatorischen Felds bewegen, haben vor allem in den Bereichen User Experience und User Interface vieles angeschoben, was wir vielleicht ein wenig vernachlässigt haben. Aber auch da holen wir deutlich auf.
Am Ende des Tages ist es so: Dem Kunden muss es schmecken – und da gehört dann nicht nur eine hippe Anwendung dazu, sondern auch der persönliche Kontakt. Das gilt auch für jüngere Bankkunden. Diese Generation ist weit davon entfernt, nur auf dem digitalen Kanal unterwegs zu sein, gerade beim Bankgeschäft. Das ist etwas sehr Persönliches, was viel Vertrauen benötigt. Entscheidend ist die Kombination aus den smarten mobilen Funktionen und dem tiefer gehenden Beratungsprozess. Da stehen dann noch die Bank und der persönliche Kontakt im Vordergrund.
Werden wir eine Genossenschaftsbank im virtuellen Raum des Metaverse sehen?
Für mich ist das eine Technologie, die noch in den Kinderschuhen steckt. Aber wir beschäftigen uns mit dem Thema in unserem Innovation Hub. Es geht dabei nicht nur um Technologie, es müssen auch Use Cases dahinterliegen. Wir haben viele innovative Banken, die auch immer wieder tolle Sachen ausprobieren. Und wenn dann eine Volks- und Raiffeisenbank dort ein Geschäftsmodell sieht, dann werden wir auf unserer Plattform entsprechende Dinge anbieten können. Ich sehe das aber eher in einem Zeitraum von fünf Jahren plus.
Sie propagieren immer wieder die Bedeutung von Ökosystemen für die Zukunft der Banken. Was verstehen sie konkret darunter?
Ein Ökosystem ist ja erst einmal das Zusammenspiel von unterschiedlichen Partnern – frei von Zeit und Raum und Technologie. Genossenschaftsbanken sind ja Ökosysteme, vernetzt in ihren Regionen, in ihren Städten, in den Vereinen und Institutionen. Dazu gehören auch viele Firmenkunden mit ihren innovativen Ideen. Ihnen allen wollen wir die Möglichkeit geben, sich nicht nur vor Ort, bei einer Veranstaltung oder in der Bankfiliale zu vernetzen, sondern auch über den digitalen Kanal. Das ist für mich das Thema: Digitalisierung und Regionalität zusammenzubringen und daraus ein digitales Ökosystem zu schaffen.
Da grenzen wir uns klar ab von den großen Playern. Amazon, um ein Beispiel zu nennen, bietet Waren auf dem digitalen Kanal an, aber da fehlt das Label „regional“. Regionalität macht die Genossenschaftsbanken aus. Das wollen wir in den Vordergrund stellen, und dafür ist es notwendig, ein digitales Ökosystem anzubieten. Auch darauf ist unsere neue Plattform ausgerichtet. In den Regionen können Vernetzungsangebote gemacht werden – seien es Informationen oder sei es die Plattform um Geschäftspartner zusammenzubringen im Sinne eines klassischen B2B. Wir liefern die Plattform. Der Content, die Geschäftsidee und auch die Umsetzung – das kommt aus den Volks- und Raiffeisenbanken.
Auf einer Skala von 1 bis 10 – wo sehen Sie die Banken im Prozess der Digitalisierung?
Wenn ich auf die Genossenschaftsbanken schaue, dann sehe ich ein heterogenes Feld. Da gibt es jene, die sind auf der Skala Richtung 8 unterwegs. Es gibt allerdings auch Banken, die sich eher im Bereich von 2 oder 3 bewegen. Deren Erfolg ist nicht geringer, es existieren eben nur unterschiedliche Philosophien, eine Bank aufzustellen.
Atruvia kommt bei der Digitalisierung eine wichtige Rolle zu. Unsere Angebote müssen es den Volks- und Raiffeisenbanken ermöglichen, ihre digitale Kompetenz sowie ihre Produkte und Lösungen den Kunden auch über den digitalen Kanal anzubieten. Da sind wir dran dank der großen Investitionsoffensive, die der genossenschaftliche Bereich gestartet hat, aber es ist schon eine Aufholjagd.
Dabei haben wir als Genossenschaftsgruppe auch einen bedeutenden Vorteil: die große Menge an Kunden. Ökosysteme, ob digital oder nicht digital, leben von Skaleneffekten. Da haben wir günstige Voraussetzungen mit Blick auf die 30 Millionen Kunden von Volks- und Raiffeisenbanken. Auf dieser Basis lässt sich eine Digitalisierung gut vorantreiben. Und dann können wir das Ganze weiterentwickeln zu einem digitalen und regionalen Ökosystem.
Überall erleben wir digitale Transformation, und auch die Atruvia durchläuft einen derartigen Transformationsprozess. Was sind diesbezüglich Ihre wesentlichen Erkenntnisse?
Einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren ist der Mensch. Eine Atruvia lebt ja von den Menschen, dem Know-how unserer Mitarbeitenden – sowohl was das Bankgeschäft betrifft als auch die Technologie. Für uns war wichtig, von der ersten Minute an alle mitzunehmen in den Transformationsprozess, in die Veränderungen unserer Kultur und der Ablauforganisation. Das heißt: Unsere Transformation folgte nicht einer Blaupause. Wir hatten zwar eine externe Begleitung, aber im Wesentlichen haben wir den Wandel aus uns selbst geschöpft.
Erfahrung Nummer zwei war, dass Sie eine Unternehmensleitung brauchen, einen Vorstand, der jeden Tag vorlebt und jeden Tag erklären kann, warum dieser Wandel notwendig ist. Sie brauchen auch einen Vorstand, der Mut hat. Nehmen wir ein monolithisch ausgerichtetes Bankverfahren, das aus der Historie gewachsen ist und gewisse Komplexitäten in Technologie und Fachlichkeit aufweist – das konfrontieren Sie dann mit den Trends auf dem Markt und dem Blick Richtung offene Plattformen … Und deswegen haben wir nicht nur den internen Wandel im Hinblick auf Agilität und kulturelle Veränderungselemente angeschoben, sondern auch einen technologischen Wandel eingeleitet.
Es ist nicht einfach, sich vor ein Team zu stellen, das über viele Jahre ein vollumfängliches Verfahren entwickelt hat und auch stolz darauf ist, und dann zu sagen: Dieses Verfahren hat seine Zeit überlebt, wir müssen in neue Technologien investieren. Was heißt das für die Menschen, wenn wir eine neue Technologie angehen? Mitarbeitende müssen möglicherweise Wissen, das sie über 20 Jahre aufgebaut haben und in dem sie sich sicher fühlen, plötzlich erneuern und sich ganz anderen Vorgehensweisen stellen.
Das setzt eine extrem große Veränderungsbereitschaft voraus, die wir unseren Kolleginnen und Kollegen abverlangen. Das funktioniert an einigen Stellen gut, an anderen Stellen nicht so gut. Was aber bleibt, ist das Wissen um die Prozesse in den Banken. Das ist ein unschätzbarer Wert – nicht nur IT zu verstehen, sondern auch das Geschäft der Kunden.
Als Vorstand müssen Sie in solchen Transformationsprozessen immer klar bleiben und dürfen nicht beim kleinsten Gegenwind einbrechen. Sie müssen dazu stehen und überzeugt sein. Und ich bin davon überzeugt, dass es richtig, notwendig und überlebenswichtig war und ist – nicht nur für unsere Kunden, sondern auch für unser Unternehmen. Aber wir haben noch ein Stück Weg vor uns, bis wir wieder in einem guten, eingeschworenen Modus sind und unsere Kunden dann noch mehr spüren, dass sich Atruvia sehr radikal, jedoch zu ihrem Vorteil verändert hat.
Zur Person: Martin Beyer